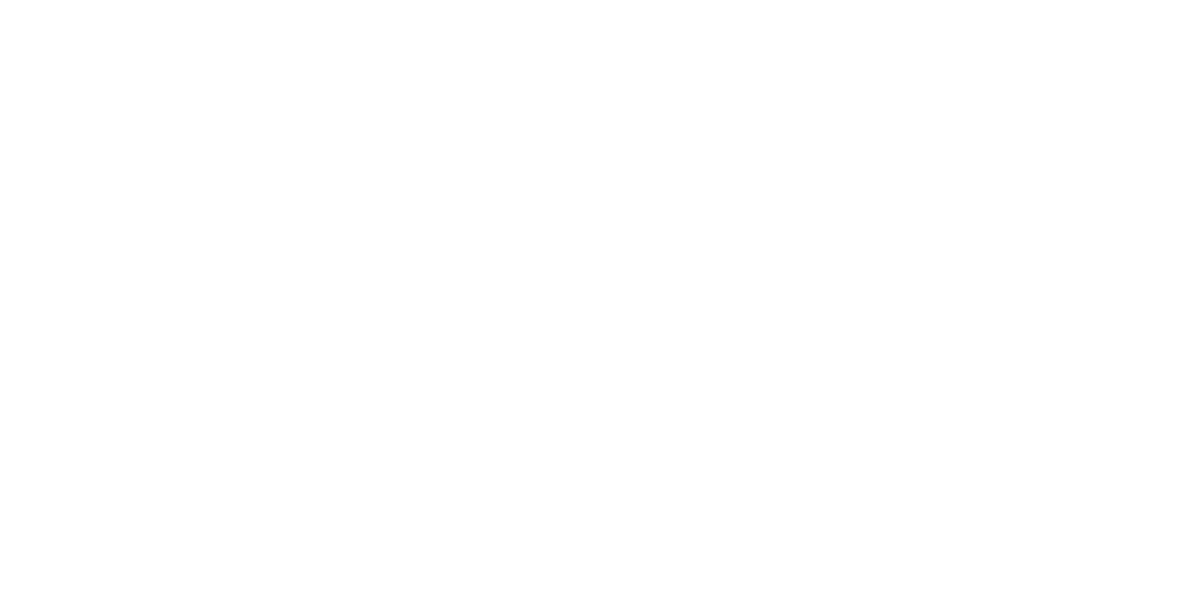ES IST WIEDER SO WEIT! Der Zürcher Mensch darf wählen, wohin sich die Stadt in den nächsten vier Jahren seiner Meinung nach entwickeln soll. Zum Beispiel, ob neue Schulsysteme an Kinderprobanden getestet werden, oder ob man doch lieber wieder zur altbewährten Prügelstrafe zurückkehrt, ob die Anzahl Parkplätze künftig diejenige der Stadtbewohner übersteigen, oder ob das vielbejammerte, vermeintliche kulturelle Überangebot in Zürich reoptimiert werden soll. Denn in einer Demokratie bestimmt man an der Urne eben nicht nur die Zusammensetzung des politischen Kräfteverhältnisses, sondern auch das Programm eines Theaters.
«WOZU BRAUCHT ES TANZFÖRDERUNG, TANZEN KANN MAN AUCH AN DER STREETPARADE!», das ist so einer jener Sätze aus einer hitzigen Debatte im Zürcher Gemeinderat, der uns nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und der erahnen lässt, wie sich das Wahlverhalten künftig in den Spielplänen der Theater niederschlagen könnte – etwa wenn die (in der jüngsten Vergangenheit nur hauchdünn gescheiterten) Vorstösse, unliebsamen Kulturinstitutionen mittels Ratsbeschluss den Geldhahn zuzudrehen, aus einer demokratischen Laune heraus plötzlich durchkommen.
Denn längst ist es nicht mehr nur die Partei mit dem Hors-Sol-Sünneli, sondern eine ziemlich bunte Koalition aus marktservilen Volksvertreter*innen, die finden, die Kultur (und mit ihr die Bildungsinstitutionen und das Gesundheits- und Sozialwesen) müsse das mit ausbaden, was die Finanzwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten verbockt hat. «FREIES THEATER IST EIN HEUTE KAUM MEHR ZU RECHTFERTIGENDES TEURES HOBBY, DAS EINE RANDGRUPPE ZUR BELUSTIGUNG EINER ANDEREN RANDGRUPPE BETREIBT! WARUM SOLL DAS DER EINFACHE STEUERZAHLER, DER NIE EINEN FUSS INS THEATER SETZT, BEZAHLEN?!», mussten wir uns neulich wieder einmal auf der Zuschauertribüne im Rathaus anhören. Und unweigerlich schiesst einem dann durch den Kopf, ob man nicht vielleicht doch einmal über die Bücher müsste und das Programm auf zahnlose Massentauglichkeit abklopfen oder eine Halbierung der Eintrittspreise in Erwägung ziehen sollte, um dadurch hoffentlich mehr Publikum zu generieren – um so unter dem Fadenkreuz der Kosten-Nutzen-Vorbeter hindurchschlüpfen zu können. Aber das sind allesamt viel zu kurzsichtige Strategien, weil ein Theater ja immer ein Verlustgeschäft ist, solange man es nicht schliesst. Insofern sind die Theater gegenüber den Angriffen aus der Politik sowieso stets in der Defensive, also gesetzten Falls man beginnt selbst daran zu zweifeln, dass die Förderung von Kunst und Kultur eine zivilisatorische Errungenschaft ist.
«VIELLEICHT TÄTE ES DIR JA GANZ GUT, EINMAL INS THEATER ZU GEHEN, ANSTATT DIESEN NEOLIBERALEN UNRAT ABZUSONDERN!», hätten wir gerne zurückgerufen. Aber weil man als Zuschauer im Rathaus nur zuhören darf und ansonsten die Klappe zu halten hat, haben wir halt im Nachhinein mal ein bisschen gerechnet. Und dabei sind wir auf das schöne Gleichnis der Landesverteidigung gekommen.
Weil Theater ist ja gewissermassen auch Landesverteidigung – also ähm gegen innen, gegen die grosse und um sich greifende Zahlen-gleich-Fakten-Ödnis, die unser hiesiges Existieren auf eine Fussnote im Statistischen Jahrbuch der Stadt Zürich reduziert1 und uns die sich daraus ergebenden Prioritäten mittels demokratischer Legitimationsvorgänge um die Ohren schlägt – ganz nach dem Motto: Die Mehrheit hat immer recht. Und wenn diese Mehrheit, dem Zeitgeist huldigend, beispielsweise lieber neue Kampfjets anschaffen will – also ähm zum Kampf gegen aussen, also quasi für das Recht, den eigenen geistigen Zerfall notfalls mit Waffen zu verteidigen, anstatt gegen die innere Fäulnis anzugehen –, dann werden halt kurzerhand jene Gärtchen zubetoniert, die einen daran erinnern, dass es vielleicht auch noch ein paar andere Prioritäten im Leben geben könnte als Start- und Landebahnen.
Das Schlimme daran ist aber nicht einmal, dass diese Asphaltpolitik so beharrlich vorangetrieben und kultiviert wird. Das Schlimme daran ist, dass wir Theatermacher*innen selber immer wieder vor dem Argument einknicken, dass unser Beitrag zum gesellschaftlichen Wohle zu viel koste – und dass sich der wahre Wert von Kunst eh nicht berechnen und empirisch belegen liesse.
Doch was heisst überhaupt «zu viel»? Der direkte Vergleich bringt es an den Tag (und niemand soll jetzt behaupten, man könne Äpfel nicht mit Birnen vergleichen):
Für den Kauf jedes einzelnen Kampfjets (Unterhalt und Betrieb noch nicht gerechnet), in dem gerade mal zwei Personen mitfliegen dürfen und der nach vielleicht vier Jahren Betrieb (in denen er ausschliesslich zum Selbstzweck Lärm und Dreck produzierte) aufgrund einer stupiden Cyberattacke für immer am Boden seine Kreise ziehen muss … also, FÜR DIE BESCHAFFUNGSKOSTEN EINES EINZIGEN KAMPFJETS KÖNNTE MAN 157 JAHRE LANG SÄMTLICHE PRODUKTIONEN DER FREIEN SZENE IN DER STADT ZÜRICH FINANZIEREN (inkl. Entlöhnung von ca. 40’000 Teilzeitbeschäftigten, bei einem hochgerechneten Total von rund 7,85 Millionen Besucher*innen, was in etwa der jetzigen Schweizer Bevölkerung entspricht). Noch Fragen?
Aber all dieses Rechnen bringt natürlich nichts, wenn man es im kommenden März aus irgendwelchen Gründen nicht an die Urne schafft – zum Beispiel, weil man aufgrund einer Premierenfeier am Vorabend verschläft, sich politisch lieber nicht exponieren will, sich ganz grundsätzlich weigert, irgendwelche amtlichen Formulare auszufüllen, oder eh einfach alles, was mit Politik zu tun hat, scheisse findet.
In diesem Sinne: Geht wählen!
Euer Fabriktheater
Silvie von Kaenel, Michael Rüegg, Michel Schröder